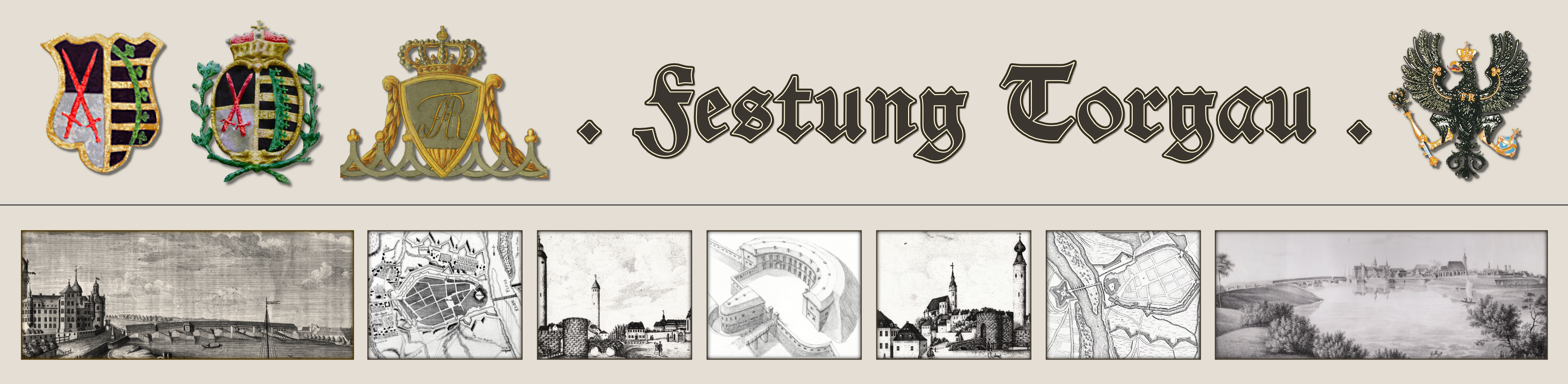
Glossar
- A -
Approche (Sappe)
ein beim förmlichen Angriff angelegter Laufgraben, der bis zum Hauptwall vorgetrieben wird.
Architrav
von Stützen getragener horizontaler Balken; bereits in der Antike als architektonisches Gestaltungselement stilisiertes, konstruktives Bauelement, dass die von Dach-, Decken- oder Wandkonstruktionen ankommenden Lasten auf die vertikalen Tragglieder überträgt.
- B -
Bankett
Schützenauftritt hinter der Brustwehr
Bastion
eine aus dem Hauptwall stark vorspringende Anlage für Frontal- und Flankierungsfeuer nach beiden Seiten. Sie entstand aus den Mauertürmen und Basteien und ihr Grundriß entwickelte sich vom Kreis über das Rechteck bis hin zur Hauptform, dem Fünfeck.
Bataillon
je nach Land 500 - 800 Mann
Batterie
die kleinste Artillerieeinheit, meist aus vier bis sechs Geschützen bestehend.
Belüftung
in Minenstollen wegen der Pulvergase lebenswichtig.
Berme
Absatz zwischen Brustwehr und Graben, verhindert Abrutschen. Bei Verteidigungswällen oft mit Übersteighindernissen (Sturmpfählen oder kräftigen Hecken) besetzt.
Bohren
der Vortrieb des Stollens von Hand oder mit Maschinen (Minenbau).
Bohrloch
dient zur Aufnahme der Sprengladung beim Vortrieb.
Bombe
war früher das Sprenggeschoss der Mörser, heute Abwurfmunition der Flugzeuge.
Bresche
eine Lücke im Wall oder in der Mauer.
Brustwehr
ein mannshoher Erdwall oder eine entsprechende hohe, kräftige Mauer, die als Deckung dienen und über die hinweg geschossen werden kann.
Büchse
Gewehr mit gezogenem Rohr, treffsicherer als Flinte.
- C -
Contrescarpe (Kontereskarpe)
die äußere Grabenwand, steil abfallend und mit einer Futtermauer bekleidet oder schräg verlaufend, dann erdgeböscht.
crenelierte (krenelierte) Mauer
eine mit Schießscharten versehene Mauer
- D -
Defensionskaserne
Kaserne zur Unterbringung von Soldaten und einer Konstruktionsart, die eine Verteidigung ermöglicht. Meist nur eine Seite (Feldseite) ist dazu mit dicken Mauern und Schießscharten versehen. Erdüberdeckungen oder verstärkte Decken schützen bei Beschuss die Insassen.
Detachement
die alte Bezeichnung für jede selbständige Abteilung.
Development
Verlauf, Abwicklung
Diamantgraben
ein Distanz schaffender, schmaler Graben als Annäherungshindernis vor einem Reduit, einer Grabenwehr oder Schartenmauer etc.
- E -
Escadron
auch Schwadron, Kavallerieeinheit in Kompaniestärke
Escarpe (Eskarpe)
die innere Grabenwand. Sie ist entweder steil abfallend und mit einer Futtermauer verkleidet oder aber schräg verlaufend und erdgeböscht.
- F -
Face (Stirn)
im weiteren Sinne die Bezeichnung jeder feindseitigen Front einer befestigten Anlage. Im engeren Sinne eine der beiden Fronten, die zum Scheitelpunkt der Spitzbastion vorspringen.
Faschine
ein Reisigbündel, das zur Befestigung von Erdreich dient.
Feldseite
die Richtung, aus der der Feind antritt.
Feuerlinie
der Brustwehr- oder Glaciskamm, über den hinweg gefeuert wird.
Flanke
im weiteren Sinn der seitliche Teil eines Werkes, von dem aus der Graben und das unmittelbare Vorfeld, auch eine benachbarte Verteidigungsanlage der Länge nach mit Flankierungsfeuer belegt werden kann. Im engeren Sinne die Verbindung zwischen Schulter und Kurtine bei der Spitzbastion.
Flesche
isoliertes Werk aus 2 einfachen Facen
Flinte
Gewehr mit glattem Rohr, rascher zu laden als Büchse
Fort
ein vorgeschobenes, zu selbständiger Kampfführung befähigtes sturmfreies Werk. Es verteidigt wichtige Punkte im Vorgelände einer Festung und zwingt einen Angreifer frühzeitig zur Entfaltung seiner Kräfte und zum Einsatz größerer Verbände für die Einschließung, wodurch die Stoßkraft seiner Feldarmee geschwächt und der Druck auf die eigentliche Festung vermindert wird. Unter dem Schutz von Forts können verschanzte Lager für Offensivkräfte errichtet werden.
Fortifikation
eine Befestigung
Fortifikationsmauer
die Mauer um eine Befestigung
Futtermauer
allgemein: Stützmauer
- G -
gedeckter Weg
ein auf der Kontereskarpe verlaufender, durch das Glacis gegen Sicht und Beschuss geschützter Weg, häufig sägezahn förmig geführt. Er ist eine vorgeschobene Verteidigungslinie und dient als Ausgangspunkt für Ausfälle und als Rückzugsort für Patrouillen.
Gegenmine
eine vom Verteidiger zur Abwehr feindlicher Angriffsminen angelegte Mine. Meist als Gegenminensystem schon rundum vorbereitet.
Geschütze
Artilleriewaffen, gliedern sich in Kanonen, Haubitzen und Mörser
Geschützmetall
Bronze (Kupfer + Zinn) für den Guss der Rohre
Gewehre
lange Handfeuerwaffe. Einteilung nach Art der Zündung des Treibladungspulvers in (chronologisch) die Vorderlader Lunten-, Rad-, Stein-, Perkussionsschloss und die Hinterlader Zündnadel- und Metallpatronengewehre 71, 84, 88 und 98
Gewehr 71
benannt nach Einführungsjahr, 11-mm-Einzellader, 1. Mausergewehr
Glacis
eine als freies Schussfeld angelegte, feindwärts flach geneigte Aufschüttung vor dem gedeckten Weg, häufig mit Annäherungshindernissen bestückt und durch Vorwerke geschützt.
Grabenschere
ein kleines Werk zwischen den Bastionsflanken, vor der Kurtine.
Grabenwehr
ein Kampfblock an der inneren (alt) oder äußeren Grabenwand (modern) zur Flankierung des Festungsgrabens.
Grenadstück
die alte Bezeichnung für Granatkanone, die im Gegensatz zur Kanone nicht nur Vollkugeln schoss.
- H -
Haubitze
ein kurzes Geschütz, das als Vorderlader im Bogenschuss Granaten warf.
Horchmine, -gang, -stollen
ein unterirdischer Gang, der zum Aufspüren feindlicher Miniertätigkeit dient.
Hohltraverse
ein mit Erde bedeckter, quer zum Wall errichteter, häufig kasemattierter Hohlraum, der von der Rückseite her zugänglich ist und als Unterstand für die Geschützmannschaft dient.
- I -
Inundation
künstliche Überschwemmung durch Anstauen
- J -
- K -
Kanone
ein Langrohrgeschütz, das im Flachfeuer schießt; als Vorderlader eiserne Vollkugeln, später als Hinterlader Granaten oder Schrapnells.
Kapitale
die gedachte Mittellinie eines Werkes, insbesondere die Winkelhalbierende des Bastionssaillants.
Kartätsche
ein großkalibriger Schrotschuss, erhält Energie nur durch die Treibladung und ist im Gegensatz zum Schrapnell bereits ab der Mündung voll wirksam.
Kasematte
war ein (Mörser-)bombensicherer Hohlraum in Festungen, der als Unterkunft, Lagerraum oder zur Geschützaufstellung diente.
Kaponniere
ein ein- oder mehrstöckiger, schußsicherer Hohlraum im Graben, senkrecht zum Verlauf des Grabens errichtet und zur niederen Grabenbestreichung dienend. Die Grabenwehr ist entweder an die Eskarpenmauer angelehnt oder sie liegt isoliert im Graben und ist durch eine Poterne mit dem Hauptwall verbunden.
Kavalier
eine überhöhende Stellung, z.B. auf einem Wall oder einer Bastion, auch in einem Angriffsgraben etc.. Sie ermöglicht eine wirkungsvollere Beherrschung des Vorgeländes an taktischen Schwerpunkten.
Kehle (Gorge)
die dem Feinde abgewandte Rückseite eines Forts. Dort liegt meist der Eingang und die diesen verteidigende Kehl-Grabenwehr.
Kommunikation
ein Verbindungsgraben oder Verbindungsgang
Kompressionsmine
ist überladen (sehr viel Pulver) und wirft daher eine hohe Minengarbe (großer Trichter).
Kordon
hier: auskragende Abdecksteine (Traufsteine) von Stützmauern (Futtermauern) oder erdbedeckten Bauten; im Geschossbau: hervorstehendes horizontales Gestaltungselement in Deckenebene (auch Etagengesims)
Krete
die alte Bezeichnung für die Kanten der Brustwehr
Kronwerk
ein Werk, das aus zwei bastionierten Fronten besteht, also aus einer von zwei Halbbastionen flankierten Spitzbastion, und das durch seitliche Anschlußwälle mit der hinter ihm liegenden Anlage verbunden ist. Das Kronenwerk entspricht zwei zusammengefügten Hornwerken. Es liegt oft vor einer Bastion.
Kurtine
der zwischen zwei Bastionen liegende Wallkörper.
- L -
Leibungen
Innenseite (Schnittseite) von Wandöffnungen
Lünette
eine Bauform von Forts, die einem durchgeschnittenen Sechseck gleicht.
- M -
Magistrale
die Hauptlinie des Festungstraces; eine gedachte Linie, die am Fuße der Eskarpenbrustwehr verläuft. Die Anlagen unterhalb der Magistrale sind der Sicht des Gegners entzogen.
Mine
ein vom Angreifer unter den Festungsmauern ausgehobener Gang, um die Anlage zum Einsturz zu bringen. Nach Erfindung des Pulvers dienten die Minengänge auch zur Anlage von Sprengkammern. Zu unterscheiden von der Mine als Sprengsatz.
Minengalerie
ein breiter Minentunnel
Minensprengstoffe
etwa ab 1500 Schwarzpulver (Schießpulver), ein Gemenge aus Salpeter (75%) Holzkohle (15%) und Schwefel (10%). Ab etwa 1880 die erheblich energiereicheren modernen Militär-Sprengstoffe, nitrierte organische Verbindungen wie Schießbaumwolle, Pikrinsäure, Tri-Nitro-Toluol (TNT); auch zivile bergmännische Sprengstoffe.
Minenvorhaus
ein überwölbter Raum am Eingang der Gegenminen.
Mineure
in Minenarbeiten ausgebildete Soldaten der Pionier- oder Artillerietruppe.
Mörser
ein Steilfeuergeschütz, das als Vorderlader „Bomben warf“
Muskete
auf Gabel aufgelegt geschossenes schweres Gewehr um 1600
- N -
- O -
- P -
Palisaden
im engeren Sinne ein oben zugespitzter Pfahl zur Befestigung, auch Schanzpfahl genannt; im weiteren Sinne eine Reihe solcher Pfähle, die ein Annäherungshindernis
darstellen.
Perkussionsgewehr
zündete regensicher durch Schlag auf Zündhütchen
Pioniere
aus Zusammenschluss von Mineuren, Sappeuren und Pontonieren entstandene technische Truppe
Polygonseite (-länge)
die Entfernung (Linie) zwischen den Spitzen zweier benachbarter Bastionen.
Ponton
bootsähnlicher Schwimmkörper zum Brückenschlag
Poterne (Hohlgang)
ist ein tunnelartig überwölbter allseits geschützter Gang, z. B. der Zugang zu äußeren Grabenwehren.
- Q -
Quetschmine
ist unterladen und macht sich daher an der Oberfläche nicht bemerkbar. Einsatz gegen feindliche Minenstollen.
- R -
Ravelin
Werk als ausspringender Winkel, vor einer Kurtine oder einem Tor
Reduit
ein selbständiger, schußsicherer und sturmfreier Kasemattenbau im Inneren einer Festung oder eines Werkes, in den sich die Besatzung zurückziehen kann.
Redute
ein aus Geraden und ausspringenden Winkeln gebildetes, dreieckiges, viereckiges oder polygonales, in napoleonischer Zeit auch trapezförmiges, geschlossenes
Werk, das entweder als Reduit in einer Bastion oder einem Ravelin liegt oder eine selbständige Verteidigungsanlage bildet.
Revetierung (Revetementmauer)
bedeutet; Erdwälle mit Mauerwerk verkleiden, was eine Revetementmauer ergibt.
Risalit
Gebäudevorsprung
- S -
Saillant
der von den Bastionsfacen gebildete ausspringende Winkel (Bastionsspitze).
Sappe
beim förmlichen Angriff im Festungskrieg hergestellte Deckung, um das Vorfeld bis zur Bresche geschützt überschreiten zu können.
Sappeure
eine französische Truppengattung, die Erdarbeiten durchführte, z.B. beim Angriff die Laufgräben.
Schanze
kleines, meist bastioniertes Erdwerk
Schießscharte
eine Maueröffnung bzw. ein Einschnitt in der Brustwehr zum Hindurchfeuern
scheitrecht
hier ein Segmentbogen mit waagerechter Unterkante und keilförmig zugeschnittenen Steinen. Bei kurzen Spannweiten wird dies auch mit unverschnittenen oder angeschrägt verlegten Steinen ausgeführt.
Schleifung
der Rückbau einer Festung
Schleppschacht
Schrägstollen; Mittelding zwischen dem waagerechten Stollen und dem senkrechten Schacht.
Steinmine (auch Fugasse, Perrier, Erdmörser)
eine Form eines Behelfsgeschützes, bei dem aus einem Trichter Steinsplitter oder ähnliches Material kartätschartig auf kurze Entfernung verschossen werden.
Steinschlossgewehr
Glattrohrvorderlader, der sein Pulver durch Funkenschlag zündet
Sturmfestigkeit
Eigenschaft einer Befestigung, einen direkten Ansturm eines Feindes einen sehr hohen Widerstand entgegenzusetzen. Ein erfolgreicher Sturm ist dann nur mit unvertretbar großen Verlusten an Menschen möglich
Sturmpfahl; Sturmpfähle
Hindernis; eine Reihe von schräg (ca. 45°) und ca. 1 m in den Boden gegrabener angespitzter Holzpfähle, die zusätzlich am Boden durch eine Schwelle stabilisiert
werden. Der Einsatz erfolgt in einem Abstand zwischen den Pfählen von ca. 8 cm als Übersteighindernis auf Bermen oder im Feld.
- T -
Tambour
kleinere hofartige Verteidigungsanlage
Tenaille (Schere, Zange)
ein aus 2 Facen des einspringenden Winkels gebildetes Werk
Tenaillenwerk
ein Befestigungssystem, das aus langen, zickzackförmigen aneinandergereihten Facen besteht, die ausspringende Winkel von etwa 60° und einspringende Winkel
von etwa 90° bilden. Das Tenaillensystem ermöglicht die gegenseitige Längsbestreichung und das Kreuzfeuer von zwei Linien aus, es beansprucht allerdings sehr viel Raum und wurde deshalb oft nur in Teilabschnitten einer Festung realisiert.
trockener Graben
ein Wallgraben der nicht gewässert ist.
Traverse
ein kompakter oder kasemattierter, quergestellter Wall hinter der Brustwehr im gedeckten Weg oder in einem Laufgraben etc., auch eine quergestellte Mauer, als
Deckung gegen das Geschützfeuer und zur Schaffung verteidigungsfähiger Abschnitte.
- U -
- V -
Verbau
im Tiefbau: Seitliche (Holz-) Wände, die das Nachrutschen der Erde in die Baugrube verhindern.
Verdämmung
ein Abschluss der Sprengkammer nach hinten, um die Wirkung der Pulvergase zum Ziel zu maximieren.
- W -
Waffenplatz
eine Erweiterung des gedeckten Weges, auf der sich Truppen für Ausfälle sammeln und Wachen aufgestellt werden können.
Wall
eine Erdanschüttung als wesentlicher Bestandteil der Festung. Der Wall entsteht durch die Aushebung eines Grabens und er kann durch Mauerwerk stabilisiert sein; häufig ist er auch kasemattiert. Auf dem Wall ist die gedeckte Aufstellung von Truppen und Artillerie möglich.
Wasserspiel
ein im Kriege abwechselndes Ablassen und Füllen der Festungsgräben, um dem Angreifer den Übergang zu verhindern.
Wolfsgrube (Fallgrube)
eine als Annäherungshindernis dienende offene oder überdeckte Vertiefung im Erdreich, häufig mit zugespitzten Pfählen bestückt.
- X -
- Y -
- Z -
Zahnfries
auch „Deutsches Band“, ein Fries aus schräg stehenden (45°) sich überdeckenden Backsteinen
Zahnschnitt
ein Fries bei dem die Form von Balkenköpfen nachgeahmt wird (bereits seit der Antike)
Zinnen
ein Aufsatz auf die Brustwehr von Verteidigungsgängen oder –mauern zum Schutze der Verteidiger; schon aus der Antike bekannt, charakteristisch für mittelalterliche Burgbauten und Stadtmauern.
Zündung
bei der mit Schwarzpulver geladenen Mine erfolgt die Zündung über eine im Zündkanal geschützt verlegte Zündschnur. Bei modernen Sprengstoffen wird die Anzündkette meist elektrisch, seltener mit Leitfeuer angezündet.
Zyklopenmauerwerk
ein Mauerwerk aus großen Natursteinen, unregelmäßig und ohne durchgehende Lagerfuge zusammengesetzt, ergibt ein polygonales Bild.
Zündnadelgewehr
erster Hinterlader, 1841 in Preußen als erstes Land eingeführt
Approche (Sappe)
ein beim förmlichen Angriff angelegter Laufgraben, der bis zum Hauptwall vorgetrieben wird.
Architrav
von Stützen getragener horizontaler Balken; bereits in der Antike als architektonisches Gestaltungselement stilisiertes, konstruktives Bauelement, dass die von Dach-, Decken- oder Wandkonstruktionen ankommenden Lasten auf die vertikalen Tragglieder überträgt.
- B -
Bankett
Schützenauftritt hinter der Brustwehr
Bastion
eine aus dem Hauptwall stark vorspringende Anlage für Frontal- und Flankierungsfeuer nach beiden Seiten. Sie entstand aus den Mauertürmen und Basteien und ihr Grundriß entwickelte sich vom Kreis über das Rechteck bis hin zur Hauptform, dem Fünfeck.
Bataillon
je nach Land 500 - 800 Mann
Batterie
die kleinste Artillerieeinheit, meist aus vier bis sechs Geschützen bestehend.
Belüftung
in Minenstollen wegen der Pulvergase lebenswichtig.
Berme
Absatz zwischen Brustwehr und Graben, verhindert Abrutschen. Bei Verteidigungswällen oft mit Übersteighindernissen (Sturmpfählen oder kräftigen Hecken) besetzt.
Bohren
der Vortrieb des Stollens von Hand oder mit Maschinen (Minenbau).
Bohrloch
dient zur Aufnahme der Sprengladung beim Vortrieb.
Bombe
war früher das Sprenggeschoss der Mörser, heute Abwurfmunition der Flugzeuge.
Bresche
eine Lücke im Wall oder in der Mauer.
Brustwehr
ein mannshoher Erdwall oder eine entsprechende hohe, kräftige Mauer, die als Deckung dienen und über die hinweg geschossen werden kann.
Büchse
Gewehr mit gezogenem Rohr, treffsicherer als Flinte.
- C -
Contrescarpe (Kontereskarpe)
die äußere Grabenwand, steil abfallend und mit einer Futtermauer bekleidet oder schräg verlaufend, dann erdgeböscht.
crenelierte (krenelierte) Mauer
eine mit Schießscharten versehene Mauer
- D -
Defensionskaserne
Kaserne zur Unterbringung von Soldaten und einer Konstruktionsart, die eine Verteidigung ermöglicht. Meist nur eine Seite (Feldseite) ist dazu mit dicken Mauern und Schießscharten versehen. Erdüberdeckungen oder verstärkte Decken schützen bei Beschuss die Insassen.
Detachement
die alte Bezeichnung für jede selbständige Abteilung.
Development
Verlauf, Abwicklung
Diamantgraben
ein Distanz schaffender, schmaler Graben als Annäherungshindernis vor einem Reduit, einer Grabenwehr oder Schartenmauer etc.
- E -
Escadron
auch Schwadron, Kavallerieeinheit in Kompaniestärke
Escarpe (Eskarpe)
die innere Grabenwand. Sie ist entweder steil abfallend und mit einer Futtermauer verkleidet oder aber schräg verlaufend und erdgeböscht.
- F -
Face (Stirn)
im weiteren Sinne die Bezeichnung jeder feindseitigen Front einer befestigten Anlage. Im engeren Sinne eine der beiden Fronten, die zum Scheitelpunkt der Spitzbastion vorspringen.
Faschine
ein Reisigbündel, das zur Befestigung von Erdreich dient.
Feldseite
die Richtung, aus der der Feind antritt.
Feuerlinie
der Brustwehr- oder Glaciskamm, über den hinweg gefeuert wird.
Flanke
im weiteren Sinn der seitliche Teil eines Werkes, von dem aus der Graben und das unmittelbare Vorfeld, auch eine benachbarte Verteidigungsanlage der Länge nach mit Flankierungsfeuer belegt werden kann. Im engeren Sinne die Verbindung zwischen Schulter und Kurtine bei der Spitzbastion.
Flesche
isoliertes Werk aus 2 einfachen Facen
Flinte
Gewehr mit glattem Rohr, rascher zu laden als Büchse
Fort
ein vorgeschobenes, zu selbständiger Kampfführung befähigtes sturmfreies Werk. Es verteidigt wichtige Punkte im Vorgelände einer Festung und zwingt einen Angreifer frühzeitig zur Entfaltung seiner Kräfte und zum Einsatz größerer Verbände für die Einschließung, wodurch die Stoßkraft seiner Feldarmee geschwächt und der Druck auf die eigentliche Festung vermindert wird. Unter dem Schutz von Forts können verschanzte Lager für Offensivkräfte errichtet werden.
Fortifikation
eine Befestigung
Fortifikationsmauer
die Mauer um eine Befestigung
Futtermauer
allgemein: Stützmauer
- G -
gedeckter Weg
ein auf der Kontereskarpe verlaufender, durch das Glacis gegen Sicht und Beschuss geschützter Weg, häufig sägezahn förmig geführt. Er ist eine vorgeschobene Verteidigungslinie und dient als Ausgangspunkt für Ausfälle und als Rückzugsort für Patrouillen.
Gegenmine
eine vom Verteidiger zur Abwehr feindlicher Angriffsminen angelegte Mine. Meist als Gegenminensystem schon rundum vorbereitet.
Geschütze
Artilleriewaffen, gliedern sich in Kanonen, Haubitzen und Mörser
Geschützmetall
Bronze (Kupfer + Zinn) für den Guss der Rohre
Gewehre
lange Handfeuerwaffe. Einteilung nach Art der Zündung des Treibladungspulvers in (chronologisch) die Vorderlader Lunten-, Rad-, Stein-, Perkussionsschloss und die Hinterlader Zündnadel- und Metallpatronengewehre 71, 84, 88 und 98
Gewehr 71
benannt nach Einführungsjahr, 11-mm-Einzellader, 1. Mausergewehr
Glacis
eine als freies Schussfeld angelegte, feindwärts flach geneigte Aufschüttung vor dem gedeckten Weg, häufig mit Annäherungshindernissen bestückt und durch Vorwerke geschützt.
Grabenschere
ein kleines Werk zwischen den Bastionsflanken, vor der Kurtine.
Grabenwehr
ein Kampfblock an der inneren (alt) oder äußeren Grabenwand (modern) zur Flankierung des Festungsgrabens.
Grenadstück
die alte Bezeichnung für Granatkanone, die im Gegensatz zur Kanone nicht nur Vollkugeln schoss.
- H -
Haubitze
ein kurzes Geschütz, das als Vorderlader im Bogenschuss Granaten warf.
Horchmine, -gang, -stollen
ein unterirdischer Gang, der zum Aufspüren feindlicher Miniertätigkeit dient.
Hohltraverse
ein mit Erde bedeckter, quer zum Wall errichteter, häufig kasemattierter Hohlraum, der von der Rückseite her zugänglich ist und als Unterstand für die Geschützmannschaft dient.
- I -
Inundation
künstliche Überschwemmung durch Anstauen
- J -
- K -
Kanone
ein Langrohrgeschütz, das im Flachfeuer schießt; als Vorderlader eiserne Vollkugeln, später als Hinterlader Granaten oder Schrapnells.
Kapitale
die gedachte Mittellinie eines Werkes, insbesondere die Winkelhalbierende des Bastionssaillants.
Kartätsche
ein großkalibriger Schrotschuss, erhält Energie nur durch die Treibladung und ist im Gegensatz zum Schrapnell bereits ab der Mündung voll wirksam.
Kasematte
war ein (Mörser-)bombensicherer Hohlraum in Festungen, der als Unterkunft, Lagerraum oder zur Geschützaufstellung diente.
Kaponniere
ein ein- oder mehrstöckiger, schußsicherer Hohlraum im Graben, senkrecht zum Verlauf des Grabens errichtet und zur niederen Grabenbestreichung dienend. Die Grabenwehr ist entweder an die Eskarpenmauer angelehnt oder sie liegt isoliert im Graben und ist durch eine Poterne mit dem Hauptwall verbunden.
Kavalier
eine überhöhende Stellung, z.B. auf einem Wall oder einer Bastion, auch in einem Angriffsgraben etc.. Sie ermöglicht eine wirkungsvollere Beherrschung des Vorgeländes an taktischen Schwerpunkten.
Kehle (Gorge)
die dem Feinde abgewandte Rückseite eines Forts. Dort liegt meist der Eingang und die diesen verteidigende Kehl-Grabenwehr.
Kommunikation
ein Verbindungsgraben oder Verbindungsgang
Kompressionsmine
ist überladen (sehr viel Pulver) und wirft daher eine hohe Minengarbe (großer Trichter).
Kordon
hier: auskragende Abdecksteine (Traufsteine) von Stützmauern (Futtermauern) oder erdbedeckten Bauten; im Geschossbau: hervorstehendes horizontales Gestaltungselement in Deckenebene (auch Etagengesims)
Krete
die alte Bezeichnung für die Kanten der Brustwehr
Kronwerk
ein Werk, das aus zwei bastionierten Fronten besteht, also aus einer von zwei Halbbastionen flankierten Spitzbastion, und das durch seitliche Anschlußwälle mit der hinter ihm liegenden Anlage verbunden ist. Das Kronenwerk entspricht zwei zusammengefügten Hornwerken. Es liegt oft vor einer Bastion.
Kurtine
der zwischen zwei Bastionen liegende Wallkörper.
- L -
Leibungen
Innenseite (Schnittseite) von Wandöffnungen
Lünette
eine Bauform von Forts, die einem durchgeschnittenen Sechseck gleicht.
- M -
Magistrale
die Hauptlinie des Festungstraces; eine gedachte Linie, die am Fuße der Eskarpenbrustwehr verläuft. Die Anlagen unterhalb der Magistrale sind der Sicht des Gegners entzogen.
Mine
ein vom Angreifer unter den Festungsmauern ausgehobener Gang, um die Anlage zum Einsturz zu bringen. Nach Erfindung des Pulvers dienten die Minengänge auch zur Anlage von Sprengkammern. Zu unterscheiden von der Mine als Sprengsatz.
Minengalerie
ein breiter Minentunnel
Minensprengstoffe
etwa ab 1500 Schwarzpulver (Schießpulver), ein Gemenge aus Salpeter (75%) Holzkohle (15%) und Schwefel (10%). Ab etwa 1880 die erheblich energiereicheren modernen Militär-Sprengstoffe, nitrierte organische Verbindungen wie Schießbaumwolle, Pikrinsäure, Tri-Nitro-Toluol (TNT); auch zivile bergmännische Sprengstoffe.
Minenvorhaus
ein überwölbter Raum am Eingang der Gegenminen.
Mineure
in Minenarbeiten ausgebildete Soldaten der Pionier- oder Artillerietruppe.
Mörser
ein Steilfeuergeschütz, das als Vorderlader „Bomben warf“
Muskete
auf Gabel aufgelegt geschossenes schweres Gewehr um 1600
- N -
- O -
- P -
Palisaden
im engeren Sinne ein oben zugespitzter Pfahl zur Befestigung, auch Schanzpfahl genannt; im weiteren Sinne eine Reihe solcher Pfähle, die ein Annäherungshindernis
darstellen.
Perkussionsgewehr
zündete regensicher durch Schlag auf Zündhütchen
Pioniere
aus Zusammenschluss von Mineuren, Sappeuren und Pontonieren entstandene technische Truppe
Polygonseite (-länge)
die Entfernung (Linie) zwischen den Spitzen zweier benachbarter Bastionen.
Ponton
bootsähnlicher Schwimmkörper zum Brückenschlag
Poterne (Hohlgang)
ist ein tunnelartig überwölbter allseits geschützter Gang, z. B. der Zugang zu äußeren Grabenwehren.
- Q -
Quetschmine
ist unterladen und macht sich daher an der Oberfläche nicht bemerkbar. Einsatz gegen feindliche Minenstollen.
- R -
Ravelin
Werk als ausspringender Winkel, vor einer Kurtine oder einem Tor
Reduit
ein selbständiger, schußsicherer und sturmfreier Kasemattenbau im Inneren einer Festung oder eines Werkes, in den sich die Besatzung zurückziehen kann.
Redute
ein aus Geraden und ausspringenden Winkeln gebildetes, dreieckiges, viereckiges oder polygonales, in napoleonischer Zeit auch trapezförmiges, geschlossenes
Werk, das entweder als Reduit in einer Bastion oder einem Ravelin liegt oder eine selbständige Verteidigungsanlage bildet.
Revetierung (Revetementmauer)
bedeutet; Erdwälle mit Mauerwerk verkleiden, was eine Revetementmauer ergibt.
Risalit
Gebäudevorsprung
- S -
Saillant
der von den Bastionsfacen gebildete ausspringende Winkel (Bastionsspitze).
Sappe
beim förmlichen Angriff im Festungskrieg hergestellte Deckung, um das Vorfeld bis zur Bresche geschützt überschreiten zu können.
Sappeure
eine französische Truppengattung, die Erdarbeiten durchführte, z.B. beim Angriff die Laufgräben.
Schanze
kleines, meist bastioniertes Erdwerk
Schießscharte
eine Maueröffnung bzw. ein Einschnitt in der Brustwehr zum Hindurchfeuern
scheitrecht
hier ein Segmentbogen mit waagerechter Unterkante und keilförmig zugeschnittenen Steinen. Bei kurzen Spannweiten wird dies auch mit unverschnittenen oder angeschrägt verlegten Steinen ausgeführt.
Schleifung
der Rückbau einer Festung
Schleppschacht
Schrägstollen; Mittelding zwischen dem waagerechten Stollen und dem senkrechten Schacht.
Steinmine (auch Fugasse, Perrier, Erdmörser)
eine Form eines Behelfsgeschützes, bei dem aus einem Trichter Steinsplitter oder ähnliches Material kartätschartig auf kurze Entfernung verschossen werden.
Steinschlossgewehr
Glattrohrvorderlader, der sein Pulver durch Funkenschlag zündet
Sturmfestigkeit
Eigenschaft einer Befestigung, einen direkten Ansturm eines Feindes einen sehr hohen Widerstand entgegenzusetzen. Ein erfolgreicher Sturm ist dann nur mit unvertretbar großen Verlusten an Menschen möglich
Sturmpfahl; Sturmpfähle
Hindernis; eine Reihe von schräg (ca. 45°) und ca. 1 m in den Boden gegrabener angespitzter Holzpfähle, die zusätzlich am Boden durch eine Schwelle stabilisiert
werden. Der Einsatz erfolgt in einem Abstand zwischen den Pfählen von ca. 8 cm als Übersteighindernis auf Bermen oder im Feld.
- T -
Tambour
kleinere hofartige Verteidigungsanlage
Tenaille (Schere, Zange)
ein aus 2 Facen des einspringenden Winkels gebildetes Werk
Tenaillenwerk
ein Befestigungssystem, das aus langen, zickzackförmigen aneinandergereihten Facen besteht, die ausspringende Winkel von etwa 60° und einspringende Winkel
von etwa 90° bilden. Das Tenaillensystem ermöglicht die gegenseitige Längsbestreichung und das Kreuzfeuer von zwei Linien aus, es beansprucht allerdings sehr viel Raum und wurde deshalb oft nur in Teilabschnitten einer Festung realisiert.
trockener Graben
ein Wallgraben der nicht gewässert ist.
Traverse
ein kompakter oder kasemattierter, quergestellter Wall hinter der Brustwehr im gedeckten Weg oder in einem Laufgraben etc., auch eine quergestellte Mauer, als
Deckung gegen das Geschützfeuer und zur Schaffung verteidigungsfähiger Abschnitte.
- U -
- V -
Verbau
im Tiefbau: Seitliche (Holz-) Wände, die das Nachrutschen der Erde in die Baugrube verhindern.
Verdämmung
ein Abschluss der Sprengkammer nach hinten, um die Wirkung der Pulvergase zum Ziel zu maximieren.
- W -
Waffenplatz
eine Erweiterung des gedeckten Weges, auf der sich Truppen für Ausfälle sammeln und Wachen aufgestellt werden können.
Wall
eine Erdanschüttung als wesentlicher Bestandteil der Festung. Der Wall entsteht durch die Aushebung eines Grabens und er kann durch Mauerwerk stabilisiert sein; häufig ist er auch kasemattiert. Auf dem Wall ist die gedeckte Aufstellung von Truppen und Artillerie möglich.
Wasserspiel
ein im Kriege abwechselndes Ablassen und Füllen der Festungsgräben, um dem Angreifer den Übergang zu verhindern.
Wolfsgrube (Fallgrube)
eine als Annäherungshindernis dienende offene oder überdeckte Vertiefung im Erdreich, häufig mit zugespitzten Pfählen bestückt.
- X -
- Y -
- Z -
Zahnfries
auch „Deutsches Band“, ein Fries aus schräg stehenden (45°) sich überdeckenden Backsteinen
Zahnschnitt
ein Fries bei dem die Form von Balkenköpfen nachgeahmt wird (bereits seit der Antike)
Zinnen
ein Aufsatz auf die Brustwehr von Verteidigungsgängen oder –mauern zum Schutze der Verteidiger; schon aus der Antike bekannt, charakteristisch für mittelalterliche Burgbauten und Stadtmauern.
Zündung
bei der mit Schwarzpulver geladenen Mine erfolgt die Zündung über eine im Zündkanal geschützt verlegte Zündschnur. Bei modernen Sprengstoffen wird die Anzündkette meist elektrisch, seltener mit Leitfeuer angezündet.
Zyklopenmauerwerk
ein Mauerwerk aus großen Natursteinen, unregelmäßig und ohne durchgehende Lagerfuge zusammengesetzt, ergibt ein polygonales Bild.
Zündnadelgewehr
erster Hinterlader, 1841 in Preußen als erstes Land eingeführt